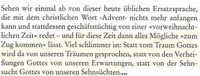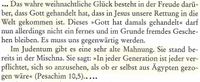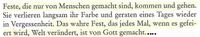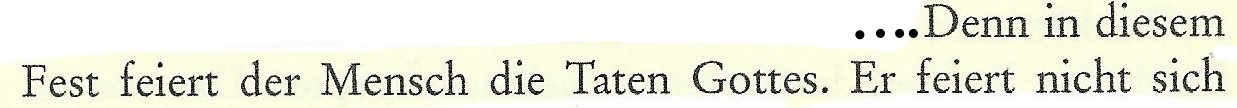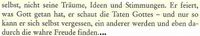1. Sonntag der Fastenzeit 2024 Jona III: Umkehr in jeder Hinsicht
Die Erzählung von Jona endet damit, dass er doch nach Ninive geht und die Bewohner warnt: ihre Stadt werde untergehen, wenn sie sich und ihren Lebenswandel nicht änderten. Mit einem Minimalaufwand von Predigt erzielt Jona maximalen Erfolg: Angefangen beim König tun alle Bewohner Buße. Und Gott "hielt inne" - so steht es im hebräischen Originaltext - und sah von seinem Urteilsspruch über Ninive ab. Jona hatte also in jeder Hinsicht Erfolg. Und doch ist er mürrisch und lässt seine miese Laune ungefiltert an Gott aus: er ist nicht damit einverstanden, dass Gott so gütig ist und die Menschen verschont, da sie zur Einsicht gekommen sind. Womöglich hat er Sorge, als "falscher Prophet" dazustehen? Oder er wollte die Erzfeinde seines Volkes in jedem Falle untergehen sehen? Wer weiß ...Gott macht ihm jedoch klar, dass Er die Menschen, wenn sie denn umkehren, nicht strafen kann.
Die Erzählung vom Propheten Jona ist mindestens eine doppelte Bekehrungsgeschichte:
Die Menschen in Ninive mussten sich bekehren von Gewalt und bösen Wegen.
Aber auch Jona musste sich bekehren.
„Hebräer“ heißt in der Landessprache Iwri. Das bedeutet „Grenzüberschreiter“. Dieses Grenzen überschreiten begann schon mit Abraham, der in ein fremdes, ihm unbekanntes Land aufbrechen sollte. Und nun musste der Hebräer Jona nach der langen Reise in das unbekannte Assyrer-Reich zuletzt auch die Grenzen seines eigenen Herzens sehen lernen und überschreiten. Der Hebräer Jona musste erkennen und akzeptieren, dass Barmherzigkeit höher steht als Gerechtigkeit und dass Gottes Menschenliebe über menschliche Feindschaften weit hinausreicht.
Das Buch Jona hält uns einen Spiegel vor. In ihm können wir in unsere eigenen Abgründe schauen.
Wieviel von diesem Jona tragen wir in uns? Wieviel von Jonas Gedanken ist uns vertraut?
Haben wir den Mut, die Grenzen unseres Herzens wenn möglich bei Notwendigkeit zu überschreiten?
Gott lehrt uns nicht ein paar schöne Verhaltensweisen zum netten Zusammenleben. Gottes Anspruch an uns ist riesengroß:
Es ist zum einen die bedingungslose Feindesliebe – dafür steht Jona.
Zum anderen ist es die radikale Hinwendung zum Guten und Menschlichen. Dafür steht Ninive. Beides ist unfassbar schwer.
Sind wir bereit, diese Lehre Gottes anzunehmen und sie zu leben?
PS: Diese Aufforderung an die Menschen in Ninive, umzukehren von den falschen Wegen, weil sonst die ganze Stadt untergeht, ist leider auch hochaktuell. Z.B. im Hinblick auf die Umweltverschmutzung und die Klimakatastrophe. Das diesjährige Hungertuch von Misereor thematisiert das auf eine künstlerisch sehr beeindruckende Weise unter dem Thema: Was ist uns heilig?
28. Januar 2024 Jona II: Auch im Fischbauch kann man beten
In meinem Beitrag vom vergangenen Sonntag hatte ich den Anfang der Geschichte des Propheten Jona betrachtet - bis zu dem Augenblick, in dem die Matrosen Jona in ihrer Verzweiflung ins Meer warfen. Der innerlich schon schwankene Jona, zerrissen zwischen dem Auftrag Gottes und seiner Weigerung, diesen zu erfüllen, hatte den äußerlich festen Boden verlassen, sich zur Flucht auf's Meer begeben und war untergegangen.
Und hier nun wird die Geschichte scheinbar gänzlich märchenhaft: "Der HERR aber schickte einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge." Die Volksmeinung hat daraus einen Walfisch gemacht hat. (Man möchte vielleicht doch immer alles so drehen, dass es irgendwie noch halbwegs gut ausgehen kann. Stellen Sie sich mal vor, das Volk hätte einen Hai vorbeikommen lassen. Da hätte ich ja für Jonas Leben keinen Deut mehr gegeben. Aber der behäbige Walsäuger erscheint uns innen schön warm und geräumig und von gutmütigerem Wesen als der Hai.)
Man lasse sich von dem Fisch nicht ablenken. Die Schrift fährt fort:
Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches.
Da betete Jona zum HERRN, seinem Gott, aus dem Inneren des Fisches heraus:
In meiner Not rief ich zum HERRN und Er erhörte mich.
Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hilfe und Du hörtest meine Stimme.
Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere; mich umschlossen die Fluten, all Deine (!) Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich sagte: Ich bin verstoßen aus Deiner Nähe.
Wie kann ich jemals wiedersehen Deinen heiligen Tempel?
Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut umschloss mich; Schilfgras umschlang meinen Kopf.
Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig.
Doch Du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, HERR, mein Gott.
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des HERRN und mein Gebet drang zu Dir, zu Deinem heiligen Tempel.
Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut.
Ich aber will Dir opfern und laut Dein Lob verkünden.
Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom HERRN kommt die Rettung.
Abgesehen von diesen wunderbaren, herrlichen Bildern im Gebet des Jonas: es sind alles Verse aus verschiedenen Psalmen; Forscher gehen davon aus, dass dieses Gebet später eingefügt wurde. Aber egal, ob eingefügt oder nicht: ein anderer Gedanke kann uns lehrreich sein an diesem Gebet. Lesen Sie hier irgendetwas von der Auftragsverweigerung des Jona Gott gegenüber? Der Mann muss doch in innerem Aufruhr gewesen sein. Oder zumindest zornig! Oder im Zwiespalt, oder ratlos ... Nichts von alledem: ihm werden Psalmverse - fertig formulierte Gebete - in den Mund gelegt, die nichts von alledem erkennen lassen. Nur Ergebenheit und Anerkennung der Größe und Barmherzigkeit Gottes. Man darf gespannt sein, wie lammfromm dieser Jona nach Ninive gehen wird, wenn er denn wieder an Land ist. Leider ist er das ganz und gar nicht, wie der Abschluss der Geschichte (siehe nächsten Sonntag) zeigen wird.
Was daran lehrreich ist? Wenn wir beten, dürfen wir mit Gott so reden, wie es uns um's Herz ist. Ich muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Psalmen sehr emotional und ausdrucksstark sind; man kann zum Beten auch sie zuhilfenehmen. Das ganze Persönliche, Bedrückendes oder himmlisch Erfreuliches, Ratlosigkeit oder Planfülle, Schönes oder Schlimmes zu unterdrücken und unausgesprochen zu lassen? Nein, so soll es nicht sein. Trauen Sie sich, Gott in Ihrem Beten Ihr Herz restlos auszuschütten, wie es in unserem wunderschönen Sprachbild heißt.
Das heißt ja nicht, dass Sie Gott Anbetung, Lob und Dank vorenthalten sollen. Dafür sind die Psalmen übrigens eine sehr gute Gebetsschule.
PS: Apropos (Wal-)fisch: Die Jona-Erzählung ist eine Lehrerzählung, keine Realität. Und sie wissen ja, wie die Orientalen so sind: Meister des Erzählens! Wieviel herrliche Literatur und wieviel leuchtende Bilder würden uns ohne sie fehlen! Da brauchen wir wahrlich nicht über die Rettung des Jona in einem Fisch zu stolpern. Sie kann uns darauf hinweisen, dass Gott, der Schöpfer des Universums, auch den Jona in schier auswegloser Situation retten kann. Und dass Jona nicht vor Gott weglaufen kann.
21. Januar 2024 Jona I: Bloss nicht nach Ninive!
Heute haben wir im Gottesdienst aus der Geschichte von Jona und dem Walfisch gehört. Es lohnt sich, dieses scheinbare Märchen in Ruhe näher anzuschauen.
Vorab aber zwei Hinweise:
1. Die Orientalen sind ein Volk mit einer sehr ausgeprägten Erzählkunst und viel Zeit.
2. Man muss sich bei einem Bibeltext immer klar machen, um was für eine literarische Form es sich handelt.
Für die Erzählung von Jona und dem Walfisch können wir sagen: es ist kein geschichtliches Buch, sondern eine Lehrgeschichte.
Hier nun der Anfang:
Das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn Amittais:
„Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir heraufgedrungen ist.“
Jona machte sich auf den Weg; doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom HERRN. Er ging also nach Jaffa (heute: Tel Aviv) hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom HERRN.
Der HERR aber warf einen großen Wind auf das Meer und es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen.
Da gerieten die Seeleute in Furcht und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. …
Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. …
Dann sagten sie zueinander: „Kommt, wir wollen das Los werfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist.“ Sie warfen das Los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn: „Sag uns doch, weshalb dieses Unheil über uns gekommen ist. Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, was ist dein Land und aus welchem Volk bist du?“
Er antwortete ihnen: „Ich bin ein Hebräer und verehre den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat.“ …
Und sie (die Männer) sagten zu ihm: „Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont?“ …
Jona antwortete ihnen: „Nehmt mich und werft mich ins Meer …! Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist.“
Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kommen; doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an.
Da riefen sie zum HERRN: „Ach HERR, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an!“ ….
Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf zu toben. …
Der HERR aber schickte einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge. Buch Jona, Kap. 1, Verse 1 ff
Ninive war die Hauptstadt des Assyrer-Reiches. Und die Assyrer waren gefürchtet als ein entsetzlich blutrünstiges, unbarmherziges Volk. Kein Wunder, dass Jona vor diesem Auftrag einfach nur abhauen wollte! Wer konnte so wahnsinnig sein und nicht nur freiwillig nach Ninive gehen, sondern den Menschen dort auch noch ihre liderliche Lebensweise vorhalten. Das war ein Himmelfahrtskommando.
Was Jona also stattdessen tut: er organisiert sich eine halbe Weltreise in die entgegengesetzte Richtung nach Tarschisch, das im Süden Spaniens liegt und für die Juden als Ende der Welt galt. Alles, bloß nicht Ninive!
Jona flüchtet vor dem Auftrag. Wie man sieht, kann er das scheinbar. Er flüchtet auch vor Gott, den er vor den Matrosen als seinen Herrn und Schöpfergott bekennt. Er flüchtet nicht nur auf äußere Weise, sondern auch innerlich, indem er sich einfach schlafen legt. Wer schläft, muss nicht nachdenken.
Und nun erzählt diese Geschichte in den Bildern ihrer Zeit einen Zusammenhang, der einen glaubenden Menschen nachdenklich machen kann: zwischen diesem vor Gott flüchtenden Jona, der Natur und den anderen Menschen kommt es zu einer Störung. Der Sturm und die Lebensgefahr, in die die Seeleute geraten, verdeutlichen das.
Es gibt Zusammenhänge zwischen der Gottesbeziehung eines Menschen und dessen Menschen in der Umgebung. Christen leben mit ihrem Glauben nicht in einem luftleeren, also beziehungslosen Raum. Ihr Verhältnis zu Gott hat Auswirkungen auf ihr Umfeld.
Jona, so wird erzählt, stellt sich dieser Situation und löst sie auf die einzig mögliche Weise. Er gibt seine Flucht vor Gott auf und liefert sich Ihm aus.
14. Januar 2024 Weder niedlich noch harmlos
Wenn ich in Familiengottesdiensten oder Katechese-Kreisen mitbekomme, wie z. B. solche Geschichten wie die vom Hirtenjungen David und seinem Kampf gegen den feindlichen „Riesen Goliath“ erzählt werden, dann bekomme ich immer ein wenig Bauchschmerzen. Das wird alles sehr nett und kindgerecht dargestellt: der kleine Hirtenjunge kämpft gegen den gemeinen Riesen. Der Clou ist dann, dass der Kleine für sein ganzes Volk den gefährlichen Gegner besiegt! Da braucht man nichts mehr groß zu sagen, nicht wahr?
DOCH! Auf solche Weise verliert diese Erzählung jegliche Brisanz. Sie verliert unsere Aufmerksamkeit. Als Kind mit einer Steinschleuder einen Riesen mit Schwert zu besiegen, ist ein kindgerechtes Märchen. Reizend. Aber was soll so eine Geschichte für uns Erwachsene?
Also der Hirtenjunge David war zwar der Jüngste der Isai-Söhne, aber keineswegs mehr ein Kind. Ein Kind konnte man nicht allein zum Vieh-Hüten schicken. Das Hüten wird ebenfalls oft genug als pastorale Idylle dargestellt. Wie der Alltag aussah, erzählt diese Riese-Goliat-Geschichte übrigens auch im Original der Bibel:
David sagte zu (König) Saul: „Dein Knecht (=David) hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot.“
So etwas kann kein Kind. Dafür muss man schon zumindest ein kräftiger Jugendlicher oder junger Mann sein.
Die nächste Sache ist die mit der Steinschleuder. Mich würde es nicht wundern, wenn nach vielen beschaulichen Katechesen in den Köpfen der meisten Erwachsenen so eine kleine, niedliche Gummifletscher-Zwille herumgeistert, mit der gemeine Jungen in unserer Schulzeit früher Papierkrampen quer durch's Klassenzimmer geschossen haben.
Mit einer echten antiken Steinschleuder konnte man ohne Weiteres die Wirkung eines Pistolenschusses erreichen, also jemanden umbringen! Allerdings brauchte der Schütze dafür auch sehr viel Armkraft – über die kein Kind verfügt. Das Ganze war also ein Kampf Mann gegen Mann, und kein Kampf "Kind gegen Riese":
„ … (David) nahm seinen Stock in die Hand, suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche … Die Schleuder in der Hand, ging er auf den Philister zu. …
Als der Philister aufblickte und David sah, verachtete er ihn, denn er war jung, rötlich und von schöner Gestalt. Der Philister sagte zu David: „Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst?“ Und er verfluchte David bei seinen Göttern. Er rief David zu: „Komm nur her zu mir, ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben.“
David antwortete dem Philister: „Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des HERRN der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der HERR mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen ….. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der HERR nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft; denn es ist ein Krieg des HERRN und Er wird euch in unsere Hand geben.“
Als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David schnell auf die Schlachtreihe zu, dem Philister entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden.
So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein; er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben.
Aus: 1. Buch Samuel, Kap. 17, Verse 1 ff
Was diese vermeintliche Kindergeschichte uns Erwachsenen sagen kann?
Der „Riese“ Goliat ist gestorben, weil er in seinem Denken und Reden viel zu arrogant und zu sehr von sich überzeugt war, als dass er die unmittelbare Gefahr hätte wahrnehmen können. Dieser Realitätsverlust hat ihn letzlich das Leben gekostet.
Und David? Er bekannte sich zum Gott Israels und verließ sich in seinem Handeln auf Ihn – und brachte eine Menge Mut auf.
Das alles kann uns zum Nachdenken bringen – und ins Gespräch mit Gott.
Aber nur, wenn wir die Erzählungen der Bibel nicht so verniedlichen, verharmlosen und zu einer reinen Kinderlektüre umwandeln, die uns „hübsch in Ruhe lässt“. Denn dafür ist die Schrift absolut nicht gedacht.
7. Januar 2024 Jesus lässt sich taufen
Heute feiert die katholische Kirche die Taufe Jesu. In der Bibel kommt einem der Bericht wahrscheinlich ziemlich unspektakulär und irgendwie altbekannt vor. Und doch enthält er einige Sätze, über die man nicht allzuschnell hinweglesen sollte.
" ... so trat Johannes, der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden.
Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen....
Johannes verkündete: "Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und Ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen."
Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als Er aus dem Wasser stieg, sah Er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: "Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen gefunden."
Markus-Evangelium, Kap. 1, Verse 4 ff
Die Taufe, die Johannes spendet, ist eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Da fragt man sich doch: Warum soll Jesus, der ohne Sünde lebt, sich eigentlich taufen lassen? Und tatsächlich: Jesus reiht sich nicht nur "ganz normal" in die Schar der Leute ein, sondern lässt sich wirklich taufen! Denken wir kurz an Weihnachten zurück. Da haben wir erfahren, dass Jesus Mensch geworden ist, Er ist einer von uns geworden, ist in unser Leben eingetreten. Das führt sich hier fort: Er stellt sich mitten unter uns, wartet, redet mit den Menschen, lässt sich taufen, so wie es auch der Wunsch der Wartenden ist, sich taufen zu lassen. Er lebt nicht abgehoben über all dem, und irgendwie immer die "Ausnahme" - Er ist wir, "in allem uns gleich, außer der Sünde." (siehe Hebräerbrief, Kap. 4, Vers 15)
Aber spätestens, wenn Jesus jetzt an der Reihe ist und zur Taufe in den Jordan steigt, muss sich etwas ändern - sonst würde diese Taufe ja zu einer ziemlich "sinnlosen Nachahmung" - Jesus bedarf nicht der Sündenvergebung. Und jetzt ändert sich auch etwas: es geschieht nicht die Sündenvergebung, sondern die liebevolle Bestätigung des Sohnes durch den Vater - in dieser Welt, in der der Sohn bis zur letzten Konsequenz Menschenschicksal angenommen hat! Das ist es, was der Evangelist mitteilen muss.
Aber bei Jesu Taufe geschieht noch so viel mehr: Am Anfang - vor der Taufe - sagt der Täufer, dass er es nicht wert sei, Jesus ("dem, der da kommen wird") die Riemen von den Sandalen zu lösen. Das ist ein Hinweis auf den damaligen Brauch: jemandem die Schuhe wegnehmen bedeutete, ihm Eigentum, Land, Gut, Besitz abzunehmen. Von Jesus wird nicht berichtet, dass Er Besitz hatte. Er ist der Herr über die Welt, die Welt ist Sein "Eigentum" - Johannes wird Ihm keine Macht "streitig machen"; mehr noch: er akzeptiert, erkennt demütig an - und bekennt vor allen, die dastehen und ja in ihm, Johannes, die wegweisende Führungsperson sehen! Was noch bei der Taufe geschieht: Am Ende spricht Gott : "Dieser ist mein geliebter Sohn ...."
Dieser Schluss ist sehr bedenkenswert: einmal mehr kann uns bewusst werden, dass wir uns Gott nicht so sehr "zurechtdenken" sollen - Gott ist unverfügbar. Vielleicht ist es der bessere Weg, sich darauf zu besinnen, dass Gott der Handelnde ist, dass Er Anfänge setzt und auch in uns Wachsen und Erkenntnis schenkt: es ist bewegend, wie am Ende des ganzen Markus-Evangeliums unmittelbar nach Jesu Tod dieser Ausspruch wieder erklingt. Als Bekenntnis (! s.o.) eines heidnischen Hauptmanns - vor allen Umstehenden: "Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!"
Und machen wir uns immer wieder neu bewusst: In der Taufe mit dem Heiligen Geist (s.o.) haben wir alle Anteil bekommen an diesem Himmel, der sich über dem geliebten Sohn Gottes aufgetan hat!
PS: Übrigens: die Wüste - Ort der Taufe Jesu - ist der biblisch bevorzugte Ort der Gotteserfahrung, der Gottesbegegnung.
Neujahr 2024 " ... und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
So schreibt es der Dichter Hermann Hesse in seinem wohl sehr bekannten Gedicht „Stufen“.
Schön passend zum Anfang eines neuen Jahres? Für viele vielleicht nicht einmal, wenn ich so die Zahl derer zusammenzähle, die sagen: „Ich habe keine Vorsätze für das neue Jahr, ich kann sie eh nicht durchhalten.“
Aus solchen Worten spricht schon eine Menge Frustration.
Leisten wir uns einen Blick in die Bibel. Denn sie ist echte Fachliteratur zum Thema „Mal wieder von vorne beginnen“. Nicht, weil das Volk Israel unfähig gewesen wäre, sondern weil es des Menschen Natur zu sein scheint, zu erlahmen, oder auf Irrwege zu kommen, oder sich einzurichten und lethargisch zu werden oder das große Ganze aus dem Auge zu verlieren und sich mit dem Klein-Klein zu begnügen.
Wie oft ist im Alten Testament von Neuanfängen die Rede: von einem Neuaufbruch nach der Regierungszeit eines schlechten Königs, von einer Neubesinnung auf Gott nach jahrelangem Götzendienst, von einem Neuaufbau aus Trümmern nach Feindüberfällen, ja sogar von Heimkommen nach langer Gefangenschaft.
Da sind Propheten, die ermutigen, die den Menschen Gottes Treue zusagen, die mit guten Worten Kraft geben:
Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat … und der dich geformt hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst,
ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir! …
Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr!
Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?
Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland. Buch Jesaja, Kapitel 43, Verse 1 + 18 f
Vielleicht sind das wichtige Gedanken beim Neu-Anfangen:
1. dass wir uns nicht fesseln und beschweren lassen sollen, von dem, was an Schlechtem oder Misslungenem war. Sicher, Nachdenken über Fehler schadet nie; Überlegungen, wie man etwas verbessern kann, bringen voran und Aussöhnung bei Zerstreitungen tut gut.
2. Sich bewusst zu machen, das wir Neuanfänge nicht allein stemmen müssen, sondern dass Gott selbst Neuanfänge setzt, die Kraft zu allem Anfang gibt und unsere Bindung an Ihn uns hält.
Der Apostel Paulus schreibt das sehr berührend in seinem Brief an die Christen in Korinth. Zuerst schreibt er darin über die schwere und gefährliche Arbeit, die er und die anderen als Apostel machen und gibt auch ganz unumwunden die Erschöpfung zu:
… so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht, wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen; wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. ... Darum werden wir nicht müde; wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert.
2. Korintherbrief, Kap. 4, Verse 7-9 +16
Besinnen wir uns und vertrauen wir bewusst auf Gottes Hilfe. Und beten wir um die innere Kraft, trotz aller Ermüdung immer wieder (kleine) Schritte in eine neue, bessere Richtung und Veränderung zum Guten hin zu wagen.
PS: Dazu mögen noch zwei Gedanken helfen, die nicht biblisch begründet, aber nachdenkenswert sind:
Der erste ist ganz einfach der Ausspruch eines lebensfrohen Piloten aus meinem Freundeskreis: „Strömungsabrisse leisten wir uns jetzt einfach mal nicht.“
Der zweite Gedanke stammt vom englischen Schriftsteller John Galsworthy und macht Mut zum kleinen, aber wichtigen ersten Schritt: „Alle Anfänge liegen in der Unordnung.“
Weihnachten 2023 Anders als der äußere Anschein
Eine Geschichte erzählt, dass ein alter Bergmann oft morgens zur Frühmesse in die Kirche kam und regelmäßig im Gottesdienst einschlief. Darüber empörten sich andere Gottesdienstteilnehmer und beschwerten sich darüber beim jungen Pfarrer: er solle das ewige Ärgernis abschaffen.
Der Pfarrer ging also schweren Herzens zum Bergmann, um sich mal mit ihm zu unterhalten.
Noch bevor er zum Problemthema gekommen war, erzählte ihm der Mann, er empfinde die Gedanken, die der Geistliche in den Gottesdiensten über Gott und den Glauben sprach, so aufbauend und anregend. Und dass er oft in den Gottesdiensten einschlafe, habe wirklich nur seinen Grund darin, dass er ja immer von der anstrengenden Nachtschicht käme und eigentlich todmüde sei. Aber er wolle einfach nicht nachhause gehen, ohne seinem Herrgott dafür zu danken, dass er gesund und wohlbehalten seine Schicht überstanden habe. Der junge Pfarrer möge es also nicht persönlich nehmen und sich nicht gekränkt fühlen, dass der alte Mann oft vor Erschöpfung zwischendurch einschlafe.
Vielleicht kennen Sie auch solche Geschichten oder Erlebnisse, die deutlich werden lassen, dass der äußere Schein längst nicht alles das zeigt, was wirklich ist (oder sogar das Gegenteil des äußeren Anscheins enthüllt); und dass das, was auf den ersten Blick verborgen bleibt, das wirklich Wesentliche ist.
So heißt es im "Weihnachtswiegenlied" von John Rutter am Ende der 1. Strophe: "... Weise knien betend vor ihrem Messias, doch liegt nur ein Kind bei der Mutter im Stall."
Der äußere Anschein: nur eine Mutter mit ihrem Kind. Das Wesentliche: dieses Kind ist der Erlöser einer aufrüstenden Welt mit ihrer teilweise haßerfüllten, teilweise furchtbar leidenden Gesellschaft.
Das Wesentliche, das wirklich Wichtige im Glauben begreifen zu lernen, geschieht manchmal in einem Augenblick, manchmal dauert es länger, manchmal lange. Ein Leben lang im Glauben wachsen und reifer werden, in der Erkenntnis fortschreiten, mit Ausdauer und auch im Zweifel "dranbleiben", im Gespräch mit Gott bleiben und offene Fragen mitunter lange vertrauensvoll aushalten - für einen solchen Weg ist Weihnachten ein guterAnfang. Auch von den Weisen, die vor ihrem Messias knien (s.o.), wird erzäht, dass sie sich auf einen langen Weg gemacht haben, um den König zu suchen, der ihnen offenbar so wichtig war.
PS: Wenn Sie über den Jahreswechsel Zeit und Muße haben, dann empfehle ich Ihnen die Gedanken Karl Rahners zum Epiphaniefest (Heilige Drei Könige): Von der seligen Reise des gottsuchenden Menschen. Sie finden diesen Text in dem Taschenbuch „Kleines Kirchenjahr“, Kapitel Epiphanie, von Karl Rahner, Verlag Herderbücherei
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes, Hoffnung schenkendes Weihnachtsfest!
17. 12. 2023 3. Advent Es ist Gott, der das Fest für uns ausrichtet
Gute Bücher sind wie Menschen: Sie rütteln wach, machen etwas Wichtiges bewusst und / oder bereichern das Leben mit guten Gedanken. Mir geht das oft so, deshalb liebe ich Bücher. Und so möchte ich Ihnen heute einige Gedanken des Theologen Gerhard Lohfink zum Thema "Fest" zitieren. Zuvor muss ich sagen, dass er sich über folgende Fürbitte zum 3. Advent sehr kritisch äußert: "Lass uns in dieser vorweihnachtlichen Zeit genug Ruhe und Stille finden, damit unsere Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen zum Zuge kommen."
Diese Gedanken stammen aus dem Buch "Alle meine Quellen entspringen in Dir" von Gerhard Lohfink, Herder-Verlag 2023, Seiten 104 ff
10. 12. 2023 2. Advent Welches Warten darf es denn sein?
Der Alltag lehrt uns etliche verschiedene Arten des Wartens: ärgerliches Warten in der Telefonschleife eines Amtes, sorgenvolles Warten beim Arzt, unvermeidliches Warten an der Supermarktkasse, sinnloses Warten im Stau ... Jeder von uns hat da so seine Erfahrungen. Solche Arten des Warten bedeuten Stress, Nervenverschleiss und Ärger. Das kann doch hoffentlich nicht gemeint sein, wenn Christen sagen, der Advent sei eine Zeit des Wartens.
Aber was ist wirklich gemeint? Wie geht Warten im Advent? Auf keinen Fall handelt es sich um dieses von außen erzwungene Warten in den erwähnten Alltagssituationen. Es handelt sich auch nicht um eine romantisch-gemütliche Art "Warten auf's Christkind".
Vielmehr geht es darum, ein Stück "Frei-Sein von ..." im Alltag zu schaffen. Eine Zeit nehmen, in der man nichts tut. Oder eine Zeit nehmen und sie mit guten geistlichen Gedanken füllen. Oder sich Zeit nehmen, die Verheißungen Gottes in Kopf und Herz klar werden zu lassen. Denn zum christlichen Warten gehören immer die Verheißungen Gottes - sie stehen in unserer Bibel. Aber wem sind sie schon immer und jederzeit bewusst? Also kann man in einem guten Warten wieder Platz schaffen für diese kostbaren, aufbauenden Worte. Man kann auch die Zeit des Warten mit Beten füllen, oder mit Stille. Auf diese verschiedenen Weisen wird das Warten des Menschen nicht zum Zeitvertreib, sondern es führt zu einer persönlichen Offenheit, in der Gott jederzeit "Platz nehmen kann" im Herzen eines Menschen. Das Herz eines Menschen "im wachen, bewussten Wartestand" ist hergerichtet und vorbereitet für Gottes Ankommen - durch Zeit, geistliche Aufmerksamkeit und Bereitschaft.
WIE und auf welche Weise Gott dann im Herzen eines Menschen ankommt - das erfährt jeder Mensch auf seine Art, und das ist Teil der Geschichte Gottes mit jedem einzelnen Menschen. Das lässt sich niemals verallgemeinern, vorgeben oder erzwingen. Aber der Mensch wird es spüren: durch Herzensgewißheit, Freude, Trost, Zuversicht ...
Es braucht nicht so furchtbar viel Zeit im Alltag. Oft ist es mehr eine Entscheidung, auf etwas anderes zu verzichten, um stattdessen diese wichtige Warte-Zeit zu gewinnen.
Ich möchte schließen mit einer der schönsten Verheißungen aus der Bibel. Sie steht beim Propheten Jesaja und ist ein zutiefst adventlicher Schrifttext: Zuspruch für das Volk Israel in sehr schwierigen Zeiten; in Zeiten in denen es um Glaubenskrisen, um gesellschaftliche Umbrüche, um Kampf gegen das wirklich Böse ging. Also - genau betrachtet - um wieder höchst aktuelle Texte, auch wenn sie schon tausende von Jahren alt sind.
Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des HERRN geht strahlend auf über dir.
Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker,
doch über dir geht strahlend der HERR auf, Seine Herrlichkeit erscheint über dir. s.u. Buch Jesaja, Kap. 60, Verse 1 f
Wir dürfen mit dieser Verheißung auf das Kommen Gottes in unsere Herzen leben und wirken - in allem persönlichen und gesellschaftlichen Dunkel. Und vielleicht macht mancher die Erfahrung, dass diese Gotteserfahrung völlig unerwartet und dann kommt, wenn man nicht damit gerechnet hat und - ehrlich gesagt - eigentlich auch schon gar nichts mehr zu hoffen wagte.
PS: Georg Friedrich Händel hat diese Verheissung im Oratorium "Der Messias" strahlen vertont: O du, die Wonne verkündet
3. 12. 2023 1. Advent Doch, doch - es hat mit Advent zu tun
In den Jahren 1596 bis 1601 lebt in der westfälischen Stadt Unna bei Dortmund der ev.- lutherische Pfarrer Philipp Nicolai. Es ist eine Zeit schlimmer religiöser und politischer Glaubenskämpfe zwischen Protestanten und Katholiken, aber auch zwischen Protestanten untereinander. Aggressiv und mit heftigen Streitschriften und Predigten kämpft Pfr. Nicolai gegen Katholiken und Calvinisten. Da bricht 1597 die Pest über die Stadt herein. Er beschreibt diese Katastrophe in Briefen mit den Worten:
„Es überfiel die Pest mit ihrem Sturm und Wüten die Stadt wie ein unversehnlicher Platzregen und Ungewitter ließ bald kein Haus unbeschädigt... und giengen die Leut mit verzagtem Gemüth und erschrockenen Hertzen als erstarret und halb todt daher“.
In dieser Heimsuchung wandelt sich Pfarrer Nicolai für die erstarrten Menschen zum Seelsorger. Da auch sein Kollege der Pest zum Opfer fällt, muss er bis zu 30 Begräbnisse am Tag durchführen. In einem Brief an seinen Bruder schreibt er: „Die Pest wütet furchtbar hier in der Stadt … Der Küster besucht die Kranken, und ich predige. Ich bin durch Gottes Gnaden noch ganz gesund, wenn ich gleich von Häusern, die von der Pest angesteckt sind, fast umlagert bin und auf dem Kirchhof wohne, wo täglich bald 24, 27, 29, 30 Leichen der Erde übergeben werden ...“
Innerhalb eines halben Jahres sterben 1400 Menschen in der Stadt. Auch zwei Schwestern des Pfarrers sind unter den Toten.
Als die Seuche endlich vorüber ist, schreibt Nicolai rückblickend an seinen Bruder: „Die Pest hat zu wüten aufgehört, und durch Gottes Gnade bin ich recht wohl. Während der Pest habe ich aber unter Hintansetzung aller Streitigkeiten die Zeit mit Gebeten hingebracht und mit dem löblichen Nachdenken über das ewige Leben ...“.
Es scheint unfassbar: während Philipp Nicolai umgeben war von Sterbenden, Toten, Verzweifelten und Trauernden, dichtete und komponierte dieser Pfarrer, der nie Poet oder Musiker war, ein Lied, das an Strahlkraft und Hoffnung kaum zu überbieten ist: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“! Es ist ein Lied gegen Tod und Verzweiflung, ein Lied, das die Herzen der Menschen gewinnt. Und während sich zur Zeit seiner Entstehung konfessionell unterschiedliche Menschen mit Worten und Waffen befehdeten, hat heute Philipp Nicolais Lied einigenden Charakter: über alle Grenzen hinweg wird es von Christen vieler verschiedener Konfessionen gesungen.
„Wachet auf“ ist kein Lied, das Weihnachten ahnen lässt; die Weihnachtsgeschichte wird nirgendwo angedeutet. Vielmehr beschreibt es die Vollendung menschlichen Lebens in der Begegnung mit Gott.
Es ist sehr dynamisch; "malt" es doch in starken Bildern die Ankunft des Bräutigams, die Vorbereitungen zum Fest, den Einzug in den Festsaal und dann mit der dritten Strophe jenen Zustand, in dem aller (oft hektische) „Zeit – Lauf“ sich in weiten, reichen, ewigen „Zeit – Raum“ gewandelt hat.
So dürfen wir uns die Ewigkeit wohl vorstellen: als das Ende des „Zeit – Laufs“, das Hinter – uns – lassen aller Hast und Eile, aller Aufgaben und Bedrückungen, aller Schmerzen und Trauer – um erlöst einzutreten in den weiten „Zeit - Raum“ jener überirdischen Freude, der Ewigkeit, die menschliche Wahrnehmung und alles bisher Bekannte unermesslich übertreffen wird.
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ ist ein Lied des Aufbruchs – und das in der Adventzeit, in der wir es uns ja eigentlich mal so richtig gemütlich machen wollten. Aber dieser Aufbruch-Charakter des Liedes ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Advent für uns zu so einer Zeit des inneren Aufbruchs werden kann.
Mit dem Weckruf „Wachet auf!“ können wir vielleicht unseren Alltag neu betrachten: all das, was sich an Schlechtem eingeschlichen hat, was sich zur Oberflächlichkeit entwickelt und uns vom bewussten Leben als Hoffende unmerklich weggezogen hat.
„Wachen“ im biblischen Sinn: aufmerksam sein, bewusst leben, gestalten, sich nicht treiben lassen. Das sind Haltungen, mit denen wir unseren Glauben im Advent erneuern können.
Text aus: "Meins Herzens Tür Dir offen ist ..." - Betrachtungen zu Adventliedern von Maria-Elisabeth Booms